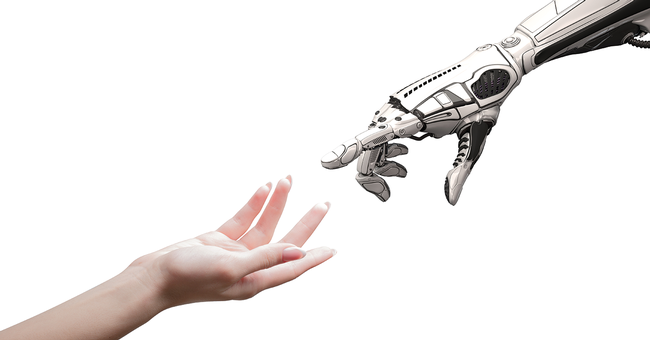Besonders Bäume übernehmen dabei eine Schlüsselrolle: Sie verbessern das Mikroklima, fördern die Versickerung von Regenwasser und steigern nachweislich das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung. Zwei aktuelle Studien des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beleuchten diese Zusammenhänge nun detailliert.
Im Rahmen des Projekts FutureBioCity erforschte ein Team unter der Leitung von Dr. Somidh Saha, Gruppenleiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), die Wirkung unterschiedlicher Baumartenvielfalt auf die menschliche Wahrnehmung städtischer Grünflächen. Ziel war es, besser zu verstehen, warum sich Menschen zu bestimmten Parkanlagen hingezogen fühlen und welchen Einfluss die Struktur und biologische Vielfalt urbaner Wälder dabei haben.
Die Ergebnisse zeigen: Orte, die eine hohe wahrgenommene Naturvielfalt aufweisen, wirken besonders anziehend und werden als angenehmer empfunden. Auch wenn ein direkter Zusammenhang zwischen messbarer Baumvielfalt und subjektivem Wohlbefinden noch nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, geben die Erkenntnisse wichtige Hinweise für die zukünftige Gestaltung urbaner Grünräume. „Vielfältig bepflanzte Anlagen könnten ein entscheidender Faktor für die Aufenthaltsqualität in Städten sein“, resümiert Saha.
Natur als Klimaschutzmaßnahme
Neben dem emotionalen und gesundheitlichen Nutzen tragen Bäume auch wesentlich zum städtischen Klimaschutz bei. In der vom KIT initiierten Studie GrüneLunge untersuchten die Forschenden die Fähigkeit von Stadtbäumen, Hitze zu mildern und bei Starkregen den Wasserabfluss zu regulieren. Gerade in dicht besiedelten Stadtteilen entstehen sogenannte Hitzeinseln, in denen sich Wärme besonders stark staut. Gleichzeitig führt die dichte Versiegelung urbaner Räume dazu, dass Regenwasser nur unzureichend versickern kann – ein zunehmendes Problem angesichts häufiger werdender Starkregenereignisse infolge des Klimawandels.
Mithilfe des Klimasimulationsmodells i-Tree HydroPlus analysierte das Team über einen Zeitraum von fünf Jahren die klimatischen Entwicklungen in mehreren Stadtteilen Karlsruhes. Die Ergebnisse sind eindrucksvoll: Würde der Baumbestand um mindestens 30 Prozent erhöht, ließe sich die Zahl extremer Hitzestunden pro Jahr um fast zwei Drittel reduzieren. Auch der jährliche Regenwasserabfluss könnte um mehr als die Hälfte verringert werden.
Resilienz durch Vielfalt
Beide Studien unterstreichen die immense Bedeutung urbaner Begrünung für die Bewältigung klimatischer Herausforderungen. Vielfältige, naturnah gestaltete Grünanlagen leisten nicht nur einen Beitrag zur physischen und psychischen Gesundheit der Menschen, sondern stärken zugleich die Klimawiderstandsfähigkeit von Städten – insbesondere in Regionen wie dem Oberrheintal, in denen laut Prognosen die Zahl extremer Wetterereignisse zunehmen wird.
Für Städteplanerinnen und Städteplaner, aber auch für die Politik, ergeben sich daraus klare Handlungsimpulse: Ein gezielter Ausbau von Baum- und Grünflächen ist kein Luxus, sondern eine notwendige Investition in die Zukunft urbaner Lebensqualität.
Originalpublikation
Johanna Krischke, Angela Beckmann-Wübbelt, Rüdiger Glaser, Sayantan Dey, & Somidh Saha: Relationship Between Urban Tree Diversity and Human Well-being and its Relevance to Urban Planning. Sustainable Cities and Society, 2025. DOI: 10.1016/j.scs.2025.106294
Rocco Pace, Theodore A. Endreny, Marco Ciolfi, Marcel Gangwisch, Somidh Saha, Nadine K. Ruehr & Rüdiger Grote: Mitigation potential of urban greening during heatwaves and stormwater events: a modeling study for Karlsruhe, Germany. Scientific Reports, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-89842-z