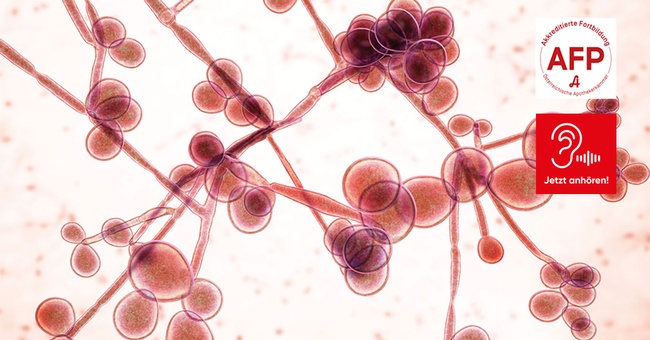Nicht alle Vertreter einer Wirkstoffklasse haben den gleichen Effekt auf die Fahrsicherheit. Die Wirkungen hängen auch von Faktoren wie Grunderkrankungen, weiterer Pharmakotherapie und Einnahmezeitpunkt der Medikation ab.
Gefahrenpotenzial abschätzen
Das Gefahrenpotenzial verschiedener Medikamente lässt sich mithilfe der Klassifikation des ICADT (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic
Safety) einschätzen. Diese basiert sowohl auf pharmakologischen Wirkprofilen als auch auf den Ergebnissen von standardisierten Fahrten. Für ältere Patient:innen bietet die Priscus-Liste zusätzlich Orientierung, indem sie neben potenziell problematischen Arzneimitteln auch besser geeignete Alternativen oder angepasste Dosierungen vorschlägt. Besonders kritisch wird es, wenn Psychopharmaka mit Alkohol oder anderen Drogen kombiniert werden - das Risiko im Straßenverkehr steigt dann exponentiell an. Man geht davon aus, dass etwa jede:r zehnte Verkehrstote unter Einfluss von Psychopharmaka stand. Potenziell verkehrsmedizinisch relevante Nebenwirkungen sind vor allem Sedierung, Schwindel, Verwirrtheit, Seh- und Bewegungsstörungen,
extrapyramidal-motorische Störungen sowie Durchblutungsstörungen des Gehirns.
Die Einnahme von Antidepressiva kann das Risiko eines Verkehrsunfalls verdoppeln. Besonders trizyklische Antidepressiva, die stärker sedierend wirken
als SSRI, beeinträchtigen die Fahrsicherheit dosisabhängig. Im Gegensatz dazu scheinen die beiden SSRI Paroxetin und Fluoxetin nur einen geringen
Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit zu haben. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass Depressionen generell mit einer verlangsamten Reaktionszeit und mit verminderter Aufmerksamkeit einhergehen. Untersuchungen zeigten, dass behandelte Personen deshalb oft eine bessere Fahrleistung erbringen als
unbehandelte.
Benzodiazepine und Z-Substanzen
Benzodiazepine und Z-Substanzen können die Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigen, da sie kognitive Einschränkungen, Schwindel, Sedierung, Verwirrtheit und Muskelschwäche verursachen können. Typische Auswirkungen sind Schlangenlinienfahren, Sprachstörungen und Gangunsicherheiten. Insbesondere bei älteren Menschen treten auch paradoxe Erregungs- und Verwirrtheitszustände auf, die u. a. mit Halluzinationen einhergehen. Das relative Risiko, durch einen Verkehrsunfall schwer oder tödlich verletzt zu werden, wird durch Benzodiazepine und Z-Substanzen um das 2- bis 10-fache erhöht.
Halbwertszeit und Einnahmezeit
Kurz- bis mittellangwirksame Benzodiazepine, die vor dem Zubettgehen eingenommen werden, beeinträchtigen die Fahrsicherheit am nächsten Morgen
in der Regel weniger. Entscheidend ist jedoch ein ausreichender Zeitabstand zwischen Einnahme und Fahrtantritt. Oft nehmen Patient:innen Schlafmittel
nicht direkt am Abend ein, sondern erst nach stundenlangem Wachliegen. Besonders bei langwirksamen Benzodiazepinen kann die Fahrsicherheit auch
noch am Folgetag erheblich eingeschränkt sein. Diese Residualwirkungen und Hangover-Effekte betreffen unter anderem die psychomotorische Leistungsfähigkeit, die visuelle Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit sowie Gedächtnis- und Informationsverarbeitungsfähigkeiten.
Anxiolytika werden hingegen häufig tagsüber angewendet. Nebenwirkungen machen sich hier daher auch bei Substanzen mit kurzer Halbwertszeit
bemerkbar und können das Unfallrisiko dosisabhängig erhöhen.
Z-Substanzen (Zopiclon, Zolpidem und Zaleplon) binden trotz ihrer andersartigen Struktur im Bereich der Benzodiazepin-Bindungsstelle an den GABAA-Rezeptor. Trotzdem werden Schlafphasen weniger beeinträchtigt. Für Zaleplon ist aufgrund der extrem kurzen Halbwertszeit von etwa einer Stunde und dem Abbau in inaktive Metaboliten schon drei Stunde nach Einnahme keine negative Auswirkung auf Gedächtnis und psychomotorische Leistungsfähigkeit
mehr feststellbar.
Längere Einnahme von Benzodiazepinen
In verschiedenen Studien wurde untersucht, ob das Unfallrisiko unter einer langfristigen Benzodiazepintherapie weiterhin erhöht bleibt. Für Diazepam, das
aufgrund seiner aktiven Metaboliten eine sehr lange Halbwertszeit hat, wurden auch nach ein- bis vierwöchiger Einnahme signifikante Nebenwirkungen festgestellt, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Das höchste Risiko besteht innerhalb der ersten Behandlungswoche. Für Oxazepam hingegen konnte nach
dieser Behandlungsdauer kein erhöhtes Unfallrisiko festgestellt werden. Der Langzeitgebrauch von Benzodiazepinen scheint also in geringerem Ausmaß zu verkehrsrelevanten Nebenwirkungen zu führen.
Bis zum Erreichen einer stabilen Dosierung und dem Abklingen von Nebenwirkungen sollte auf eine aktive Teilnahme am (motorisierten) Straßenverkehr verzichtet werden. Benzodiazepine können die Fahrsicherheit über mehrere Wochen bis Monate erheblich einschränken. Zudem können nach einer Einnahmepause, einem Präparatewechsel oder einer Dosisanpassung erneut Beeinträchtigungen auftreten. Symptome wie kognitive und motorische Defizite, Schwindel, Benommenheit oder Müdigkeit können auftreten und machen es notwendig, das Autofahren bis zur Symptomfreiheit zu unterlassen.
Quellen
- Gunja N.: In the Zzz zone: the effects of Z-drugs on human performance and driving. J Med Toxicol 2013; 9(2): 163-71
- www.der-arzneimittelbrief.com/artikel/2009/arzneimittel-und-fahrtuechtigkeit-im-strassenverkehr. Zugegriffen: 29. Jan. 2024
- Bödefeld T, et al.: Einschränkungen der Mobilität von älteren Verkehrsteilnehmern durch Medikamente, Alkohol und Cannabis. Bundesgesundheitsblatt 2024; 67: 903–909
- Skopp G, et al.: Medikamente und Fahrsicherheit. Rechtsmedizin 2020; 30: 471–479
Sabine_Klimpt.jpg)