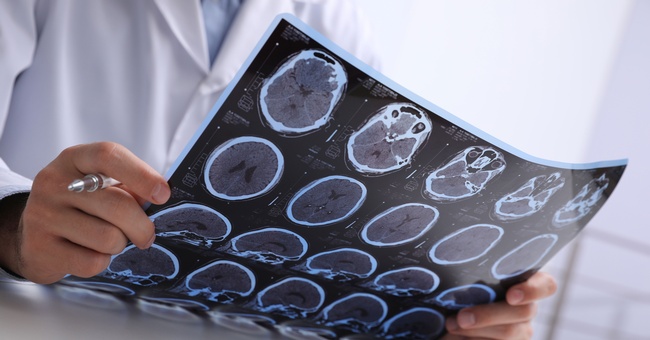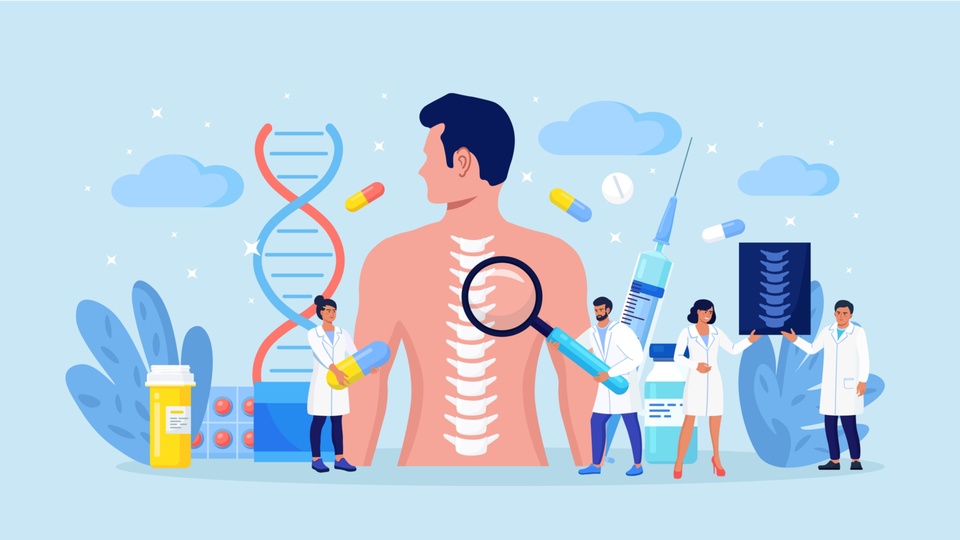
„Viele glauben, Osteoporose ist fad und betrifft wenige, aber das stimmt nicht“, betonte Dr. Maya Thun. Pro Sekunde ereignet sich global eine Fragilitätsfraktur. Das Lebenszeitrisiko beträgt für Frauen 1:3 und für Männer 1:5. Rund 552.000 Österreicher:innen sind betroffen, mehrheitlich Frauen. Österreich rangiert im europäischen Vergleich zudem in einem unerfreulichen Spitzenfeld und belegt Platz 3 bei der Schenkelhalsfraktur-Inzidenz. Dies ist besonders dramatisch, weil sich nach einer bereits erlittenen Fraktur das Risiko für weitere Knochenbrüche verdoppelt bzw. im ersten Jahr nach einer Wirbelkörperfraktur sogar verfünffacht.
Mortalität nicht unterschätzen
Die Mortalität nach osteoporotischen Frakturen ist erschreckend hoch – etwa 25 % der Patient:innen sterben innerhalb eines Jahres nach einer Schenkelhalsfraktur. „Die Osteoporose ist keine Bagatelle. Die Mortalität ist vergleichbar mit einer bösartigen Krebserkrankung“, warnte Thun. Schwedische Daten zeigen: Osteoporose-bedingte Fragilitätsfrakturen stehen bereits an dritter Stelle der Sterbestatistik – nach kardiovaskulären Erkrankungen, aber noch vor vielen Krebsarten. Dabei sind Männer nach Frakturen stärker gefährdet zu versterben als Frauen.
Diagnostik: Mehr als T-Score
Die Diagnostik hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich weiterentwickelt. „Der T-Score allein ist weder eine Diagnose der Osteoporose noch ein verlässlicher Marker des Fragilitätsfrakturrisikos“, erklärte Thun. Heute steht die Bestimmung der Knochenstärke im Vordergrund, wozu neben der Knochendichtemessung (DXA) auch die Beurteilung der Mikrostruktur mittels TBS (Trabecular Bone Score) gehört. Besonders hervorzuheben: Etwa 50 % der Fragilitätsfrakturen treten bei Frauen mit T-Scores im osteopenischen Bereich (-1 bis -2,5) auf, und nicht im osteoporotischen Bereich < -2,5.
Paradigmenwechsel in der Therapie
Die aktuellen Leitlinien haben einen grundlegenden Wandel erfahren: Die Therapieentscheidung basiert nicht mehr primär auf dem T-Score, sondern auf dem individuellen Frakturrisiko. Dazu bieten sich Frakturrisikorechner wie FRAX (online frei zugänglich) oder die Risikokalkulation in der neuen DVO-Leitlinie an.
Sowohl die österreichischen als auch die internationalen Leitlinien unterscheiden nun drei Risikokategorien: niedrig, hoch und sehr hoch. Die Therapieempfehlungen haben sich entsprechend angepasst:
• Bei sehr hohem Frakturrisiko (≥ 10 % in 3 Jahren): primär knochenanabole Therapie
• Bei hohem Frakturrisiko (5–10 % in 3 Jahren): antiresorptive Therapie
• Bei niedrigem Risiko: Lebensstilberatung, Calcium/Vitamin-D-Supplementierung
Versorgungslücke in Österreich
Trotz der hohen medizinischen und ökonomischen Relevanz besteht in Österreich eine eklatante Unterversorgung: Nur 20 % der Patient:innen erhalten nach einer Fraktur im Krankenhaus eine spezifische Osteoporose-Therapie. Nach 18 Monaten sind es sogar nur noch 10–15 %, die weiterhin behandelt werden. Dies steht in krassem Gegensatz zur Dringlichkeit einer schnellen Intervention. Denn bei Hochrisikopatient:innen mit bereits bestehenden Frakturen gilt: „Time is bone“ – je früher die Therapie beginnt, desto besser. Studien zeigen, dass die Abfolge der Medikamente entscheidend ist: Eine anfängliche Verwendung von Bisphosphonaten vermindert die Wirkung einer nachfolgenden anabolen Therapie. Umgekehrt ist die Sequenz „erst Knochenaufbau, dann Antiresorption“ deutlich effektiver.
Take-Home-Messages
• Osteoporose ist eine Volkskrankheit mit hoher Morbidität und Mortalität, die in ihrer Bedeutung oft unterschätzt wird.
• Die Therapieentscheidung basiert auf dem individuellen Frakturrisiko, nicht nur auf dem T-Score.
• Bei hohem Frakturrisiko sollte rasch therapiert werden – bei sehr hohem Risiko primär mit knochenanabolen Substanzen.
Text: Dr. Maya Thun
Fachärztin für Innere Medizin, Wien