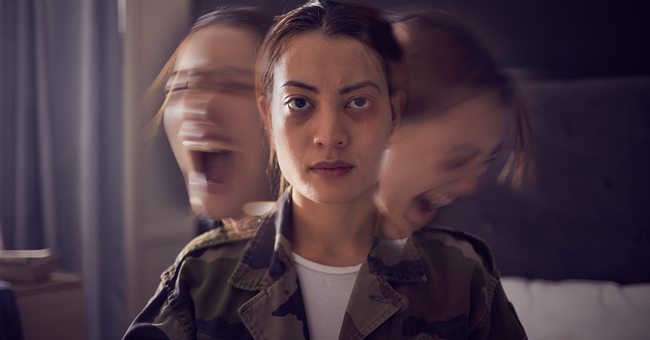Vor Behandlungsbeginn mit einem Depotpräparat sind Wirksamkeit und Verträglichkeit sicherzustellen (durch orale Vortherapie mit dem Wirkstoff bzw. mehrwöchige Testung). Neben den bekannten unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) jedes Arzneistoffs (siehe Teil 1, ÖAZ 05/25) können zusätzlich injektionsbedingte UAW auftreten.

Technologie der Depotformulierungen
Eine Wirkstofffreisetzung über mehrere Monate ist durch verschiedene Technologien erreichbar:
- Bei Depotantipsychotika der ersten Generation ist der Wirkstoff durch Fettsäureveresterung schwer löslich und daher meist in öligen Lösungen formuliert. Deren Viskosität macht die Handhabung schwieriger (Stichwort Aufziehen) und die Applikation schmerzhafter. Bsp: Haloperidol als Decanoat in Sesamöl, Flupentixoldecanoat in MCT
- Später folgten Wirkstoffe in schwerlöslicher Prodrug-Form (z. B. verestert) als wässrige Suspension. Die Freisetzung (z. B. Esterhydrolyse) ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Der Steady-State wird nach Wochen bis Monaten erreicht. Anfangs sind eine orale überlappende Medikation bzw. Loading Dosen nötig. Bsp: Paliperidon, das als Palmitat praktisch unlöslich ist, in Wasser, aber als Nanopartikel suspendiert verarbeitet ist, oder Aripiprazol, das per se als Wirkstoff schwer wasserlöslich ist, aber als lyophylisiertes Pulver in wässriger Suspension verabreicht wird.
- Polymer-basierte Depots, z. B. als Mikropartikel, enthalten den Wirkstoff und geben ihn ab, wenn sie abgebaut werden. Die Latenzzeit bis zur Wirkstofffreigabe macht eine orale Überlappung nötig. Bsp.: Risperidon in Mikrosphärenpartikeln aus Pulver-Poly-Milchsäure-Glykolsäure ist mit dem wässrigen Lösungsmittel suspendierbar.
- Risperidon ISM (In-Situ-Mikropartikel Technologie) ist eine Depotsuspension in Polyglactin und DMSO als Löse-/Dispersionsmittel, bei der ein Wirkstoffteil schnell, der Rest verzögert freigesetzt wird. Der Steady-State wird nach der ersten Dosis erreicht, es ist keine anfängliche orale Ergänzung oder Aufsättigungsdosis notwendig.

LAI auf Station
Bei Aufnahme von Patient:innen auf einer fachfremden Station fehlt oft bei Ärzt:innen und Pflege die Erfahrung und Routine mit den antipsychotischen Depotpräparaten. Hier einige mögliche Fallstricke: Manche Präparate wie Haloperidol oder Zuclopenthixol gibt es sowohl als schnell wirksame Injektionen für Akutfälle als auch als Depot, Fluanxol gibt es in verschiedenen Stärken.
Es kann zu Fehlern beim Aufdosierungsschema bzw. bei der oralen Überlappung kommen, ebenso bei der Rekonstitution (manche Präparate sind schwierig zu lösen bzw. lange zu schütteln oder zu schwenken, manche müssen vorab auf Raumtemperatur gebracht werden).
Tipps, Anwendung, Beratung
Krankenhausapotheker:innen müssen bei der Definition und Spezifikation von Parametern sowie bei der Evaluierung von Informations- und Kommu-nikationstechnologien (IKT) für die Arzneimittelprozesse einbezogen werden.
Damit wird sichergestellt, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen imallgemeinen IKT-System des Krankenhauses einschließlich ‚electronic health’ (eHealth) und ‚mobile health’ (mHealth) integriert werden.
Schlechte Vorerfahrungen mit „Spritzen“
Atypika werden besser toleriert; moderne Depotformulierungen sind als wässrigen Lösungen weniger schmerzhaft bei der Applikation.
Start
Wie komplex ist das Schema (z. B. orale Überlappung, Loading Dose, Boosterung)? Wie oft muss der/die Patient:in in die Praxis gehen? Was muss kontrolliert werden?
Im Laufe der Therapie
Wie ist das Injektionsintervall? Wie komplex sind Rekonstitution und Verabreichung, wie zeitaufwendig die Gabe für den/die Patient:in? Wie ist das Medikament zu lagern?
Verabreichungstermin verpasst
Die Dosis nachholen, Gabe von mehreren Injektionen bzw. der Wieder-Beginn einer oralen Therapie können erforderlich sein. Bei verspäteter Gabe kann sich das Regelintervall nach hinten verschieben. Wichtige Faktoren: Um welches Präparat handelt es sich (Vorgehensweisen lt. Fachinformationen und Leitlinien)? Wie lange ist die Dosis ausständig? Ist man in der Start-/Boosterungsphase oder bereits in der Erhaltungsphase?
Wirkung entspricht nicht der Erwartung
Wurde bei (sehr) adipösen Patient:innen eine längere Kanüle verwendet, um einer versehentlich subkutanen Verabreichung vorzubeugen? Gibt es genetische Besonderheiten (v. a. CYP 2D6 und CYP 2C19 ), die trotz Normdosis niedrige Spiegel bewirken und gibt es entsprechende Empfehlungen zur Dosierungsanpassung? Lösung kann eine Individualisierung der Therapie sein.
| Charakteristika von Depotformulierungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aripiprazol | Olanzapin | Risperidon ISM | Risperidon | Paliperidon | |
| Präparat | Abilify Maintena® | ZypAdhera® | Okedi® | Risperdal Consta® | Xeplion®/Trevicta® |
| Wirkmechanismus | Schwer wasserlösl.Wirkstoff, langsame Absorption | Langsam auflösendes Pamoatsalz in wässr. Susp. | 2-phasige Wirkstofffreisetzung aus in situ microparticles | Microsphärenpartikel in wässr. Susp. | Schwer lösliches Palmitat in wässr. Susp. |
| Dosierintervall | Monatlich | 2-4 Wochen | 4 Wochen | 2 Wochen | Monatlich/ 3 Monate |
| Verabreichung | i. m. Deltoideus/ Gluteus | i. m. gluteal; 3 h medizin. Observanz (Postinjektions- syndrom) | i. m. Deltoideus/ Gluteus | i. m. Deltoideus/ Gluteus, Seite wechseln | i. m. Deltoideus/ Gluteus; während Aufsättigung nur Deltoideus |
| Rekonstitution | Ja, mind. 30 Sek. kräftig schütteln | Ja Durchstechflasche auf eine feste Unterlage klopfen, heftig schütteln | Ja | Ja, mind. 10 Sek. kräftig schütteln | Nein, Fertigspritze |
| Kühllagerung | Nein | Nein | Nein | Ja; bis zu 7 Tage bei RT haltbar; 30 Min vor Rekonsti-tution aus KS entnehmen | Nein |
| Umstellung | Orale Medikation 14 Tage fortsetzen | Aufsättigung in ersten 2 Monaten | Start etwa 24 h nach letzter oraler Risperidon-Dosis, keine Aufsättigung oder ergänzende orale Gabe | Orales Risperidon noch 3 Wochen | Aufsättigung nach 1 Woche (Xeplion®), danach bei stabiler Einstellung Switch möglich (Trevicta®) |
Therapeutic Drug Monitoring
Die Blutentnahme erfolgt unmittelbar vor der nächsten Depotinjektion. Mangels fundierter Evidenz für spezifische Referenzwerte und aufgrund der variablen, mehrmonatigen Halbwertszeiten orientiert man sich an den Steady-State-Konzentrationen der oralen Therapie – trotz tendenziell niedrigerer Serumspiegel bei Depotform. Gemäß Leitlinien wird der patientenspezifische Referenzbereich durch Messungen bei optimaler klinischer Wirkung ermittelt. End-of-dose-Phänomene können individuell kürzere Injektionsintervalle erforderlich machen.
Fazit
Depotpräparate können Patient:innen, Familie und Betreuungspersonen entlasten. Die ständige Auseinandersetzung mit der Erkrankung und (mehrmals) tägliche orale Arzneimitteleinnahme rücken in den Hintergrund, Diskussionen um die regelmäßige Medikamentengabe fallen weg. Wichtig ist die Wissensvermittlung über Krankheit, Symptome, Verlauf, erhöhte Mortalität und entsprechende Wichtigkeit einer konsequenten Behandlung.
Quellen
Literatur bei der Autorin